Hauptinhalt
Glocken-Glossar: Von C wie Chalandamarz bis T wie Tierschutz.
Kuhglocken sind eine Tradition, die Menschen aus der ganzen Welt in die Schweiz lockt. Was unter anderem die Kühe davon halten, lesen Sie hier.
Chalandamarz

Der bündnerische Chalandamarz gehört zu den Schweizer Bräuchen, bei denen Kuhglocken eine zentrale Rolle einnehmen. Am ersten März – dem alten römischen Neujahr – ziehen Kinder und Jugendliche durch die Strassen, tragen Gedichte und Lieder vor, knallen mit Peitschen und schütteln Kuhglocken. Über Graubünden hinaus bekannt wurde dieser Brauch durch das 1945 erschienene und noch heute beliebte Kinderbuch von Selina Chönz: «Schellen-Ursli». Der Chalandamarz ist ein gutes Beispiel dafür, dass Traditionen auch mit der Zeit gehen können: War das Lärmen und Singen bislang nur Jungen vorbehalten, ist es inzwischen auch Mädchen erlaubt, daran teilnehmen.
Geläut

Ein Geläut ist eine Gruppe aus Glocken, die aufeinander abgestimmt sind. Die Kunst besteht darin, einen für die Besitzerin oder den Besitzer möglichst harmonischen Klang zu erzielen. Dadurch, dass jede Herde ein eigenes Geläut hat, kann sie unter mehreren Herden herausgehört werden. Feinen Ohren fallen fehlende Tiere sofort auf: Die Glocke jeder einzelnen Kuh klingt anders; daher verändern fehlende Glocken auch den Klang des Geläuts. Übrigens – in gewissen Kantonen folgt das Geläut traditionellerweise der Tonleiter.
Glocke oder Schelle

Kuhglocken sind meist gar keine Glocken, sondern Schellen, in der Schweiz auch Treicheln genannt: Sie sind aus Blech geschmiedet, verschweisst oder vernietet und haben einen leicht scheppernden, dumpfen Klang. Im Gegensatz dazu werden Glocken aus Metall, meist einer Kupferlegierung, gegossen. Sie klingen melodiöser, sind aber schwerer und empfindlicher – bereits ein Riss oder Sprung kann sie zum Verstummen bringen.
Glockenfriedhof

So nannte man im Ersten und Zweiten Weltkrieg Plätze, auf denen vor allem Bronzeglocken gesammelt wurden, um sie anschliessend für Kriegszwecke weiterzuverarbeiten. Doch auch schon Napoleon liess Glocken in Waffen umschmelzen.
Magie

Ursprünglich wurden Glocken, die es seit etwa 4500 Jahren gibt, zu Kultzwecken benutzt, meist als Schutz vor bösen Geistern und Unheil. Dieser magische Nutzen blieb bis heute erhalten, wenn auch eher im Zuge feierlicher Bräuche. Etwa wenn das Neujahr begrüsst und dabei mit lautem Glockengeläut böse Dämonen verjagt werden. Auch auf uns Menschen hat der Klang von Glocken eine magisch anmutende Wirkung – dass gewisse Frequenzen und Schwingungen sich positiv auf Geist und Körper auswirken können, macht sich nicht nur die Klangtherapie zunutze. Allein schon dem langen Ausklingen von Glocken zuzuhören – bis zum allerletzten Ton –, kommt einer Meditation gleich und vermag tief innen zu berühren.
Schellenrichter
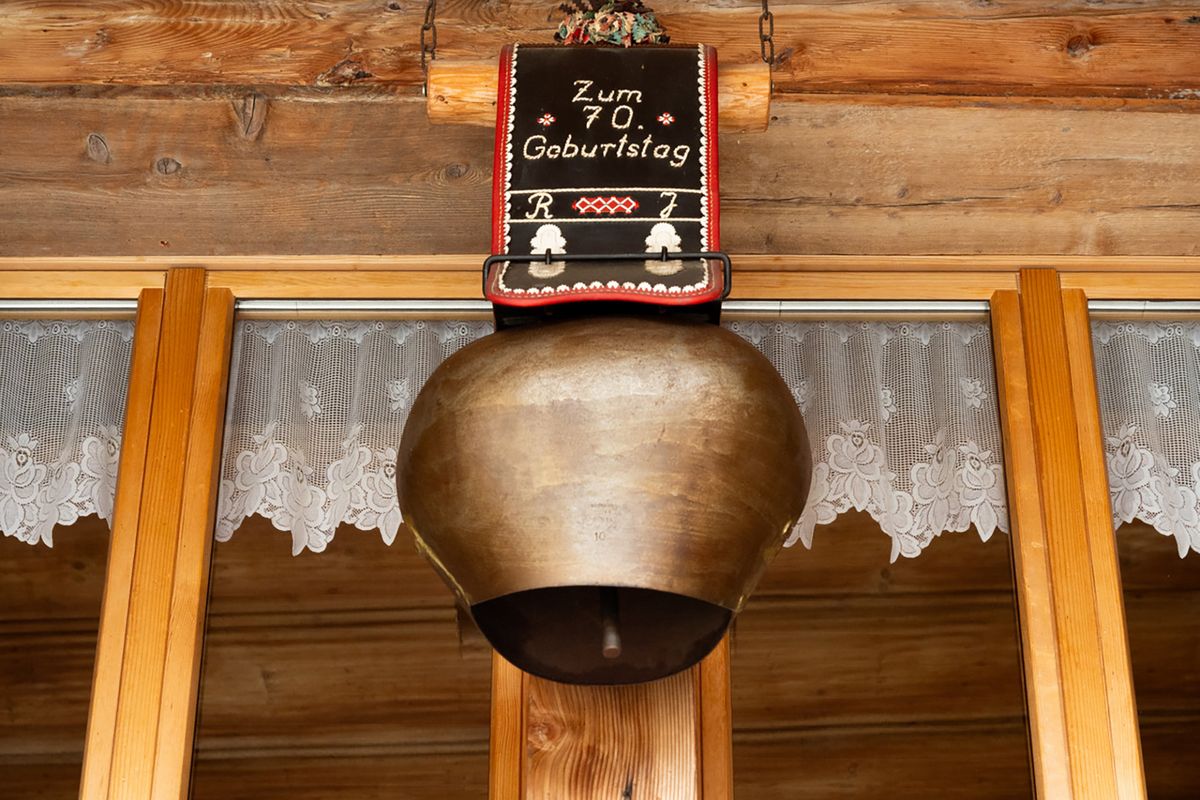
Durch den Gebrauch können sich Schellen verstimmen, etwa wenn sie beim Trinken der Kühe an den Brunnenrand schlagen. Früher gab es dafür den Schellenrichter, der die Schellen nachstimmte, indem er etwaige Risse und Sprünge flickte, Dellen ins Blech schlug oder sie an den richtigen Stellen abfeilte. Will man Glocken stimmen, ist dies zwar möglich, aber mit deutlich mehr Aufwand – das Abschleifen geschieht auf einer eigenen Stimmdrehbank.
Tierschutz

2014 führte die ETH eine klein angelegte Studie über die schädlichen Einwirkungen von Kuhglocken durch. Das vorsichtig formulierte Fazit: Je nach Lärm und Gewicht der Glocke könnte das Fress- und Liegeverhalten der Kühe beeinträchtigt sein; für sicherere Aussagen bräuchte es weiterführende Studien. Die ETH-Studie wurde vielfach kritisiert – so wurden zum Beispiel 5,5 kg schwere Schellen für die Studie benutzt. Täglich getragene Weideschellen hingegen wiegen zwischen 800 g und höchstens 2 kg. Glaubt man Bäuerinnen und Bauern, gewöhnen sich die Kühe schnell an ihre Glocke, die sie ihr Leben lang behalten, und stören sich nicht daran. Im Gegenteil: Leitkühe seien sich der besonderen, weil grösseren Glocke bewusst und trügen sie mit Stolz.






